
S. 4
Short Report Nr. 12
1 Zusammenfassung und Fazit
Der sorgsame Umgang mit Geld ist für Kinder und Jugendliche ein wichtiges Lernfeld im Rahmen
der Selbststeuerungs- und Autonomieentwicklung, das sich auch auf das Feld der Online-Käufe
bezieht. Die Möglichkeit und Notwendigkeit, für den Spielspaß in beliebten Online-Games In-
Game-Käufe zu tätigen, birgt für die Heranwachsenden allerdings das Risiko, unabsichtlich oder
unbedacht Geld auszugeben, möglicherweise sogar mehr, als sie wollen oder dürfen. Dies ist zum
einen dem Umstand zuzurechnen, dass der Überblick über virtuelle Guthaben und Ausgaben an
sich bereits mehr kognitive Leistung erfordert als der Umgang mit Münzen und Geldscheinen. Zum
anderen erschweren die komplexen und teilweise manipulativen Kostenstrukturen vieler Games
das planvolle und reflektierte kostenbezogene Handeln, was zu erhöhten Ausgaben führen kann,
wie in diversen Veröffentlichungen der jüngeren Zeit bereits aufgezeigt wurde (jugendschutz.net
2021, Kammerl et al. 2023, Meschik et al. 2024). Hierzu gehören beispielsweise intransparente
In-Game-Währungen mit „krummen“ oder sich immer wieder ändernden Wechselkursen sowie
Dark Patterns, die zu irrationalem Handeln verführen können. Die Unmöglichkeit, Restbeträge
der In-Game-Währung zu investieren, ohne zusätzliche Beträge zu erwerben, die wiederum
Restbeträge entstehen lassen, stellt ein Beispiel dar. Ein anderes Beispiel sind Kaufangebote, die
in spielbezogenen Drucksituationen platziert werden. Zudem kann bei bestimmten Spielstrukturen
das Risiko überhöhter Ausgaben mit anderen Phänomenen des Kontrollverlusts verknüpft sein,
wie den Risiken des exzessiven Spielens (Dreier et al. 2016) und der Heranführung an Glücksspiel
(BzKJ 2024).
Was 12- bis 14-Jährige von gamesbezogenen Kosten halten, wie sie insbesondere mit In-
Game-Käufen umgehen und auf welche Schwierigkeiten sie dabei treffen, ist das Thema des
vorliegenden zwölften ACT ON! Short Reports. Im Jahr 2024 nahmen 65Kinder und Jugendliche
an elf Gruppenworkshops teil, in denen über Geldausgaben für Online-Games diskutiert wurde. Die
Fragebogenangaben der Teilnehmenden sowie ihre Diskussionsbeiträge wurden– in Anlehnung
an drei Dimensionen von Medienkompetenz (vgl. Digitales Deutschland 2020)– im Hinblick auf die
kognitiven, affektiven und kritisch-reflexiven Fähigkeiten der Heranwachsenden im Umgang mit
den Kosten ausgewertet.
Nahezu die Hälfte der Teilnehmenden findet das Thema ‚Kosten in Games‘ wichtig. Zwei Drittel
haben in Games schon einmal Geld bzw. Guthaben ausgegeben, über ein Drittel gibt an, dies „immer
mal wieder“ oder „regelmäßig“ zu tun. Einzelne Befragte machen dagegen deutlich, dass sie von
Investitionen in Games wieder Abstand genommen haben, weil dieses Thema in ihrer Peergroup
an Bedeutung verloren hat oder weil die Kosten als zu hoch empfunden wurden oder gar aus dem
Ruder liefen.
Die in Games investierten Beträge, die die Teilnehmenden erwähnen, bewegen sich häufig im
Taschengeldbereich, über die Zeit kommen bei einigen jedoch Summen von mehreren Tausend
Euro zustande. In den Diskussionen wird deutlich, dass in der Altersgruppe soziale Normen
verhandelt werden, welche Geldbeträge und welche Kauffrequenzen als vertretbar gelten. Die Mittel
für die Käufe stammen in der Regel aus dem Taschengeld oder aus Geschenken von Verwandten.
Häufig sind auf den genutzten Geräten oder in den Apps Zahlungsmittel der Eltern hinterlegt und
je nachdem, welche Vorkehrungen die Eltern diesbezüglich treffen, sind die Heranwachsenden
zu selbstständigen Käufen in der Lage oder auf elterliches Zutun angewiesen. Einige umgehen
die Eltern, indem sie Geschwister oder Freund*innen mit alternativen Transfermöglichkeiten in
Kaufprozesse involvieren. Von den Teilnehmenden als vorteilhaft geschätzt werden store- und
game- bzw. spieleplattformbezogene Guthabenkarten, die im Einzelhandel gekauft werden
können. Durch das Prepaid-Prinzip ist ein Kostenlimit gesetzt, das die ausgabenbezogene
Selbstkontrolle unterstützt. Guthabenkarten ermöglichen den Kindern und Jugendlichen zudem
größere Autonomie– sowohl ausgabenbezogen als auch die Spielauswahl betreffend–, sofern
die Eltern nicht weitere Kontrollen und Sicherungen einbauen, etwa durch die Aktivierung von
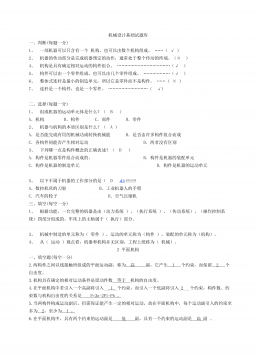
 2024-11-15 27
2024-11-15 27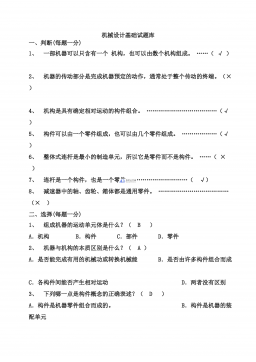
 2024-11-15 16
2024-11-15 16
 2025-04-07 11
2025-04-07 11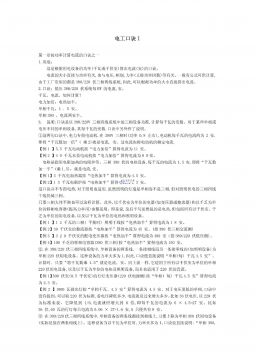
 2025-04-07 7
2025-04-07 7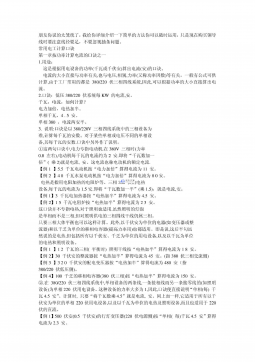
 2025-04-07 11
2025-04-07 11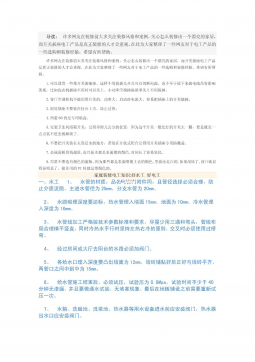
 2025-04-07 7
2025-04-07 7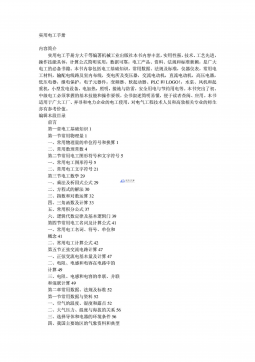
 2025-04-07 8
2025-04-07 8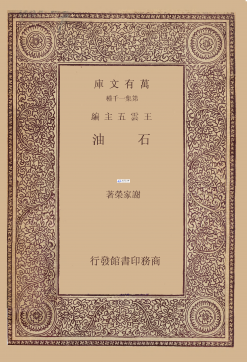
 2025-04-07 6
2025-04-07 6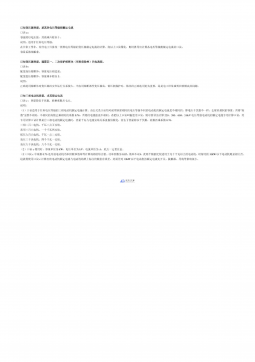
 2025-04-07 8
2025-04-07 8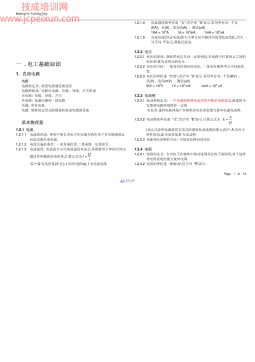
 2025-04-07 11
2025-04-07 11

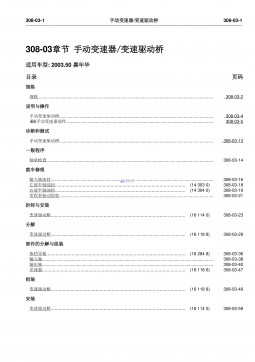





 渝公网安备50010702506394
渝公网安备50010702506394
