
Seite 2 29. Jg. Heft 1/2 März/Juni 2006
ZEP
Alfred K. Treml
Kann durch Erziehung die
Gesellschaft verändert werden?1
Zusammenfassung: Der Verfasser formuliert in diesem Text
aus dem Jahr 1982, der im gleichen Jahr in der ZEP veröf-
fentlicht wurde, eine der zentralen Fragen des Globalen
Lernens. Häufig wird mit diesem Erziehungskonzept der
Anspruch vertreten, die (Welt)Gesellschaft zu verändern oder
zumindest dafür zu sorgen, dass sich die Lebensbedingun-
gen auf diesem Planeten nicht verschlechtern.
Treml geht im Folgenden dieser Frage nach, indem zu-
nächst die unterschiedlichen Antwortmöglichkeiten aus der
Disziplin dargestellt, dann deren sprachliche Bedingungen
nachgezeichnet und schließlich deren Funktion reflektiert
wird. Der Autor kommt zu dem Ergebnis, dass diese Frage
als eine „irreführende, aber nicht sinnlose elementare Fra-
ge“ interpretiert werden kann.
Abstract: In this article of 1982, published in ZEP in the
same year, the author presents one of the fundamental ques-
tions of Global Learning. Referring to this educational con-
cept it is often assumed, that (world-)society might be change-
able or at least that the life-conditions on this planet might
not get worse.
Treml considers the question presenting firstly the diffe-
rent answer-positions within the discipline, secondly draw-
ing its linguistic conditions and thirdly reflecting its func-
tion. The author states that the question can be interpreted
as a misleading but not senseless basic question.
Es ist in der Pädagogik üblich, auf ein gestelltes Thema in
der Weise zu reagieren, dass man sich zuerst einmal in der
umfangreichen und oft sogar unübersehbaren Literatur dazu
umsieht und sich dabei fragt, was die Autoren, die pädagogi-
schen Klassiker, dazu schon einmal geschrieben oder gesagt
haben. Dieses Vorgehen dürfte die Regel darstellen, und häu-
fig erschöpft sich die Arbeit auch schon darin, denn bekannt-
lich kann die Lektüre unzähliger Bücher das eigene Denken,
anstatt es in Gang zu bringen, auch erschlagen. Gleichwohl
ist die Einbindung in einen tradierten Denkzusammenhang
eine sicherlich notwendige, wenn auch nicht per se schon
hinreichende Bedingung des wissenschaftlichen Arbeitens.
I
In unserem Falle erbringt ein flüchtiger, aber neugieriger
Blick in die pädagogische Fachliteratur der letzten 200 bis 300
Jahre folgendes aufschlussreiche Ergebnis: Auf die in mei-
nem Thema gestellte Frage werden drei klare und eindeutige
Antworten gegeben: ja, nein und – jein. Mit „ja“ antworten
die „pädagogischen Optimisten“. wie ich sie einmal nennen
möchte, angefangen von Comenius, Leibniz, Kant, Schleier-
macher, Fichte und vielen Frühaufklärern des 17. und 18. Jahr-
hunderts über die meisten Reformpädagogen zu Beginn die-
ses Jahrhunderts bis hin zu H. J. Gamm und H. J. Heydorn, um
nur zwei aktuelle Stimmen zu nennen, bis hin schließlich zum
„Lernbericht“ des Club of Rome, können wir deutliche Spu-
ren von diesem pädagogischen Optimismus entdecken (vgl.
die Übersicht bei Werder 1975, S. 18 ff. sowie Fend 1974, S.
235 ff.). Ihnen gemeinsam ist die Überzeugung, dass Erzie-
hung einen Beitrag zur Gesellschaftsveränderung – und das
heißt immer auch: Gesellschaftsverbesserung – leisten kann,
ja, dass Erziehung geradezu der Motor des gesellschaftlichen
Fortschritts sei, auch wenn nur wenige Stimmen so empha-
tisch klingen wie jene von Johann Balthasar Schupp, der schon
im 17. Jahrhundert schrieb: „Wann wir aller Orten wohlbest-
alte Schulen hätten, darinn die Jugend recht unterwiesen
würde, hätten wir innerhalb zwantzig Jahren eine neue Welt
und bedörfften keiner Büttel oder Scharffrichter“ (zit. nach
Titze 1973, S.19).
Dagegen waren nun die „pädagogischen Pessimisten“,
wie ich sie nennen will – sie würden sich wohl als „Realisten“
bezeichnen –, der Meinung, dass Erziehung nun wohl doch
das Letzte sei, wodurch eine Gesellschaft verändert werden
könne. Dieser Kreis, in dem solche Töne anklingen, ist eine
illustre und sehr heterogene Gesellschaft. Sie reicht von
Wilhelm Dilthey über Siegfried Bernfeld und Norbert Elias bis
zu den marxistischen Bildungstheoretikern unserer Tage, die
in der Erziehung nur die „Reproduktion des Kapitals“ erbli-
cken können (vgl. die Übersicht bei Werder 1975, S. 21 ff.)
und zu den systemtheoretischen Schultheoretikern Niklas
Luhmann und Karl-Eberhard Schorr, die lapidar erklären: „In
der gesamten gesellschaftlichen Evolution ist Erziehung nie
Schrittmacher struktureller Transformationen gewesen, son-
dern jeweils auf sie gefolgt“ (Luhmann/ Schorr 1979, S. 26)2 –
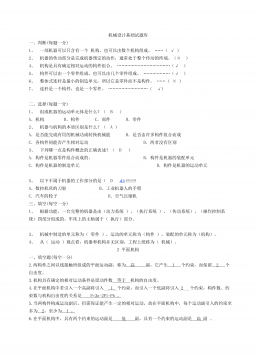
 2024-11-15 27
2024-11-15 27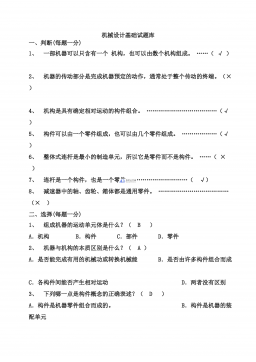
 2024-11-15 16
2024-11-15 16
 2025-04-07 11
2025-04-07 11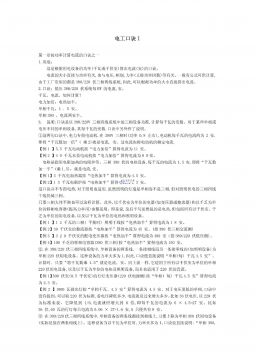
 2025-04-07 7
2025-04-07 7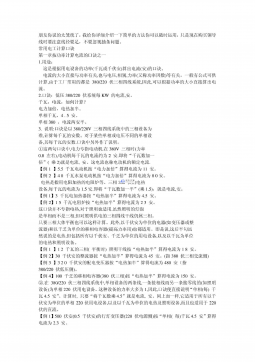
 2025-04-07 11
2025-04-07 11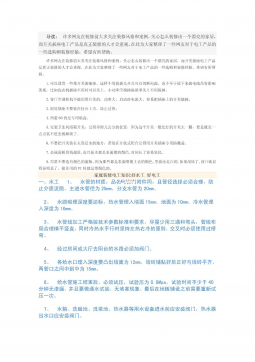
 2025-04-07 7
2025-04-07 7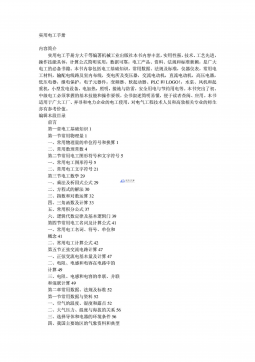
 2025-04-07 8
2025-04-07 8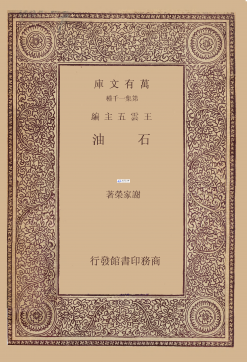
 2025-04-07 6
2025-04-07 6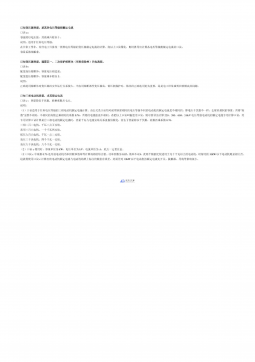
 2025-04-07 8
2025-04-07 8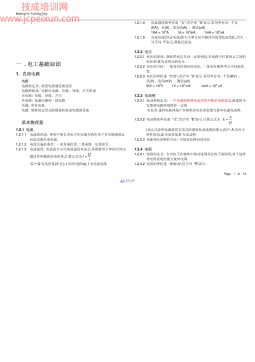
 2025-04-07 11
2025-04-07 11

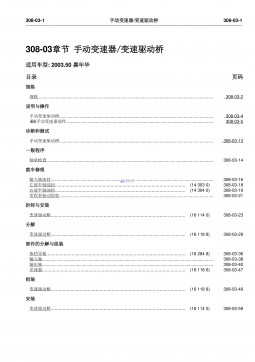





 渝公网安备50010702506394
渝公网安备50010702506394
